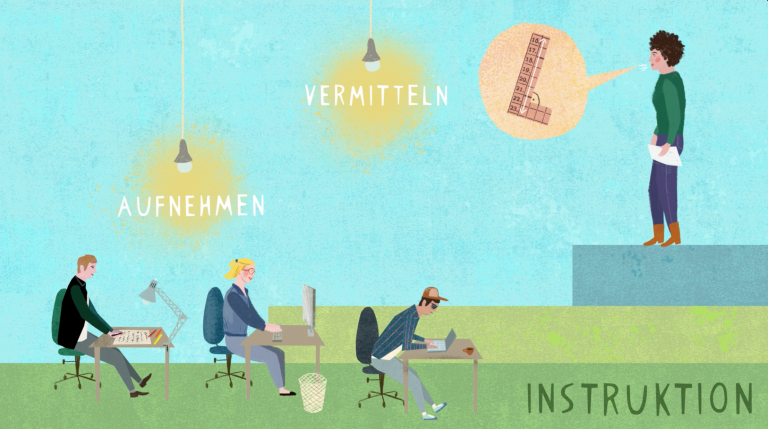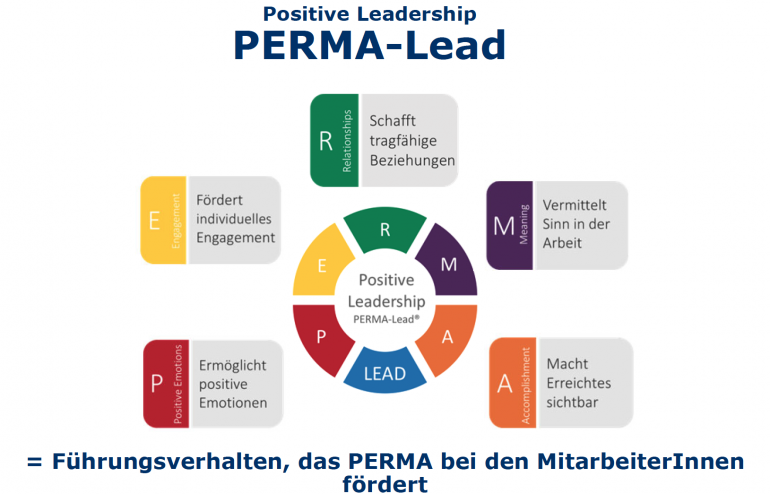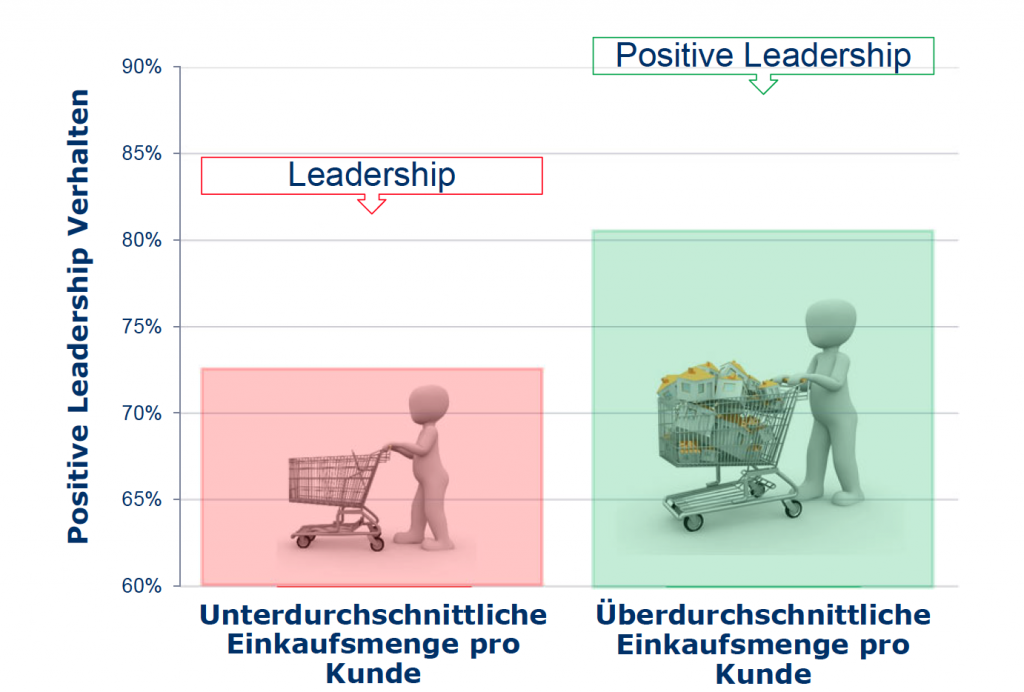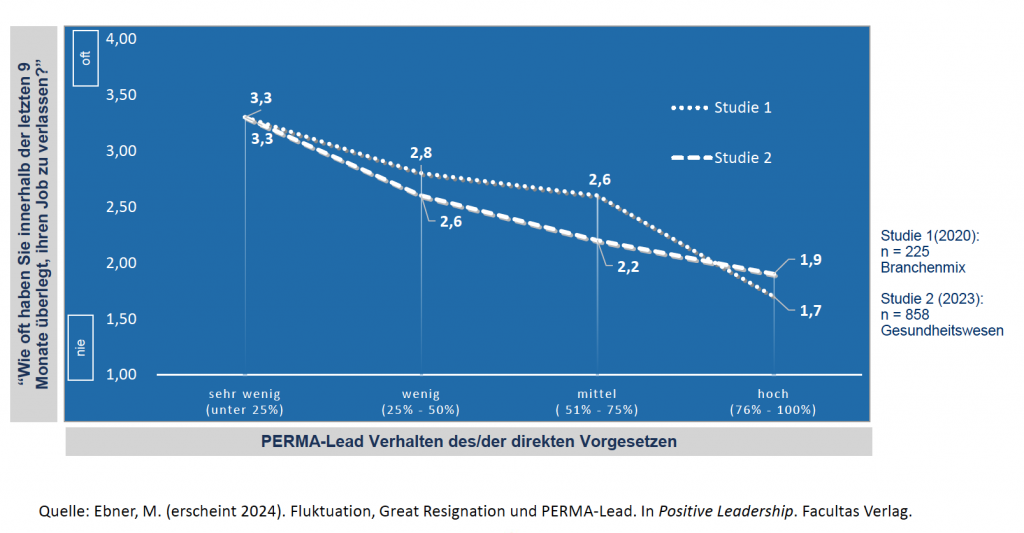Wenn ich mit meinen Kunden und auch mit meinen Freunden über ihre aktuellen Situationen austausche, höre ich sehr unterschiedliche Beschreibungen:
Einzelne freuen sich über die Verlangsamung und über die geschenkte Zeit, um bei dem schönen Wetter den Garten zu geniessen, zu lesen, einen Artikel zu schreiben, für die eigene Fitness zu sorgen und mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Andere befinden sich in grossem Stress zu Hause im Homeoffice, in zahlreichen Videokonferenzen, haben das aufwändige Homeschooling zu bewältigen, die Kinder bei Laune zu halten und die Familie mit Essen zu versorgen. Wieder andere stecken in grossen Sorgen, ob sie ihr Unternehmen mit Kurzarbeit gut am Leben erhalten können. Und die zahlreichen Menschen im Gesundheits- und Altersbereich bemühen sich darum, einen passenden Umgang mit dem Covid-19-Virus zu finden, um kranken und alten Menschen in Isolation eine professionelle und zugewandte Pflege und Unterstützung zukommen zu lassen – arbeiten bis zur Leistungsgrenze, permanent der Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Und schliesslich höre ich von Menschen in Isolation, in banger Hoffnung, ob sie den Virus überleben werden.
Wir befinden uns seit Wochen in einer Ausnahmesituation, die wir so noch nicht erlebt haben. Corona hat sich von einer entfernten Gefahr zu einer akuten Pandemie entwickelt, die massive Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft mit sich bringt. Diese ernste Situation befeuert Emotionen, die wir unter Kontrolle bringen müssen, um weiterhin klug entscheiden und handeln zu können. Wir befinden uns im «Vor-Sicht-Modus», täglich darum bemüht, ein der Situation angemessenes Verhalten zu entwickeln. Die genutzte Technik ist zwar hilfreich, im Wesentlichen geht es aber um unser Verhalten – um Beobachten, Experimentieren und darum, im Denken, Fühlen, Wollen und Tun Neues zu ermöglichen. Radikalität wird sichtbar und wir staunen, was alles in kurzer Zeit möglich ist: Engpässe werden ausgeglichen, Verzicht wird in erstaunlichen Situationen möglich, Hilfe wird in grossem Ausmass mobilisiert, Chancen werden wahrgenommen und neue Erkenntnisse herbeiexperimentiert.
IN SOLCH HERAUSFORDERNDEN ZEITEN IST DIE WIDERSTANDSKRAFT DER MENSCHEN, UNSERE RESILIENZ GEFORDERT.
Für die einzelnen Menschen bedeutet das, sich den grossen Herausforderungen und Ängsten zu stellen, sie anzunehmen und den Blick für neue Möglichkeiten zu öffnen. Dazu muss es immer wieder gelingen, nicht im ängstlichen Gedankenkarussell stecken zu bleiben, sich gut und schnell erholen zu können, unkonventionelle gedankliche Verbindungen zuzulassen und sich kreativen Ideen zu öffnen.
Organisationale Resilienz fokussiert neben den eingespielten Routinen, neben Erfolgs-, Wachstums- und Effizienzbestrebungen auf die Beobachtung der neuen Phänomene, auf das Stellen von Fragen, auf Reflexion und Flexibilisierung. Gleichzeitig gewinnt die Fähigkeit der Mitarbeitenden, in einen schnellen, ehrlichen Austausch zu kommen, die gemeinsame Reflexion, die Regenerationsfähigkeit und die Beobachtung von Belastungsgrenzen an eminenter Bedeutung.
Ich nehme wahr, wie in Organisationen achtsames Führen wichtig wird – präsent, im intensiven Austausch, mit klaren einfachen Regeln aber sehr reflexiv (auch wenn das weitgehend nur über Distanz möglich ist). Menschen, die Halt geben und Orientierung schaffen, werden bedeutsam.
In diesem Zusammenhang gewinnt eine schon recht alte Methode* wieder an Bedeutung: die Achtsamkeit. Achtsamkeit zeigt sich als Gewinn für Unternehmen und Mitarbeitende.
WAS IST ACHTSAMKEIT?
Achtsamkeit ist eine besondere Form der Aufmerksamkeit. Achtsamkeit bedeutet Bewusstheit oder auch Geistesgegenwart. Wir nehmen wahr, was jetzt passiert, in einer sehr dem Leben zugewandten Art. Unsere Haltung ist dabei von Interesse und Neugier geprägt. Wir sind nicht im Widerstand mit dem, was wir erleben.
Ist Ihnen aufgefallen, wie schnell sich die Natur in den letzten Wochen entwickelt hat? Anfangs gab es auf den Bäumen noch keine Blätter; heute blühen Tulpen, Forsythien, Zier- und Obstbäume und Flieder, fast alle Laubbäume sind beblättert. Antworten Sie jetzt: „Sowieso, ist ja nicht zu übersehen!“ oder „War ja auch schon Zeit!“ oder antworten Sie jetzt: „Ja, ich habe es ganz bewusst wahrgenommen und mich täglich darüber gefreut!“?
Scheinbar selbstverständliche Dinge achtsam wahrzunehmen bzw. Tätigkeiten achtsam durchzuführen ist in unserem Alltag gar nicht einfach. Wir laufen oft im „Autopilot-Modus“, der ja in vielen Dingen auch sehr hilfreich ist: So müssen wir z.B. beim Autofahren nicht über jeden einzelnen Blick, Handgriff oder die korrekte Pedalbetätigung nachdenken. Auch im Berufsleben funktionieren wir routiniert und primär rational: vergleichen, abwägen, analysieren, bewerten, kategorisieren, gegenüberstellen, prüfen, messen, delegieren … da bleibt einfach keine Zeit für Achtsamkeit, wozu auch? Es läuft ja wunderbar so!
Aber egal ob privat oder beruflich: Je mehr wir uns dazu verführen lassen, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun und in Gedanken jeweils schon zwei Schritte voraus (oder bei etwas ganz anderem) zu sein, desto größer wird die Gefahr von Stress, Hektik und Unzufriedenheit. Unser Gehirn kann sich nur mit einer Sache gleichzeitig beschäftigen. Daher schalten wir beim Multitasking ständig zwischen verschiedenen Netzwerken im Gehirn hin und her. Langfristig verlieren wir beim Multitasking unsere tiefe Konzentrationsfähigkeit. Und langfristig können uns Stress, Hektik und Unzufriedenheit sogar krank machen. In Zeiten wie diesen kommt bei vielen Menschen noch Angst hinzu.
Achtsamkeit kann in herausfordernden Lebenssituationen sehr gut dabei unterstützen, Widerstandskraft, Gelassenheit und Vertrauen in die eigenen Ressourcen aufzubauen.
Beobachtungsdistanz
Mit Achtsamkeit lernen wir, eine Beobachtungsdistanz aufzubauen. Zwischen uns selbst – und unseren Gedanken und Situationen. Wir erleben, dass Gedanken kommen und gehen – wenn wir sie loslassen. Und dass wir unseren Gedanken nicht immer glauben müssen. Es ist enorm hilfreich, sagen zu können: „Da war ein Gedanke, dass ich Angst haben sollte.“ Alternativ kann man auch sagen: „Ein Teil von mir hat Angst.“
Damit desidentifiziert man sich von dem Gefühl und den daraus resultierenden Reaktionen. Man verdrängt die Angst nicht. Nimmt sie aber auch nicht als die einzige Wahrheit: Ein Teil von mir hat Angst, ein anderer Teil ist ganz zuversichtlich.
Das heisst, ich nehme wahr, was im Hier und jetzt passiert, denke mit und bin mir meiner Emotionen, meines Körpers, des Kontextes bewusst – ohne Widerstand, ohne Abwehr, ohne Wertung. Das bedeutet nicht, mit allem einverstanden zu sein und das bedeutet auch nicht, Geschehnisse oder Bedrohungen zu leugnen. Wir nehmen wahr, was ist und erhalten Zugang zu unseren geistigen Potentialen. Unsere Wahlfreiheit steigt. In unserem Gehirn ist damit das limbische System (emotionales Gehirnareal) weniger aktiv, wir reagieren stärker aus unserem Frontalhirn.
WAS BRINGT UNS ACHTSAMKEIT?
Regelmässige Achtsamkeitsübungen und Meditieren sind einfach und haben viele positive Auswirkungen auf unseren Geist und unseren Körper. Wir werden selbstbewusster, fokussierter, konzentrierter und energetischer. Wir gewinnen an innerer Stärke und Wachheit, während wir uns gleichzeitig entspannen.
Achtsamkeitsübungen helfen ausserdem…
… herunterzukommen, wenn wir gestresst sind,
… unsere Ängste besser in den Griff zu bekommen,
… schlechte Gefühle und Gedanken abzufedern und positiver durchs Leben zu gehen.
Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass bereits nach 8 Wochen regelmässiger Übung die Gehirnstruktur umgebaut ist:
- Es gibt höhere Aktivität im linken präfrontalen Cortex (Glückserleben).
- Der Hyppocampus (Nervenzellfabrik, zuständig für die Verarbeitung von Emotionen und Lernprozessen, Schaltstelle zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis) wächst und verästelt sich besser.
- Die Amygdala (Angstzentrum) verkleinert sich.
- Schmerzen reduzieren sich.
- Bluthochdruck normalisiert sich.
- Und das Immunsystem verbessert sich.
Unternehmen wie Google und SAP haben bereits zehntausende Ihrer Mitarbeitenden an Achtsamkeitsseminaren teilnehmen lassen. Sowohl die Teilnehmenden als auch die Unternehmen berichten von signifikanten und messbaren Veränderungen im persönlichen Wohlempfinden, im Umgang mit Stress, in der kreativen und intuitiven Problemlösungsfähigkeit und in der Zusammenarbeit. Die Trainings führten auch zu einer Erhöhung der Produktivität, zu geringeren Krankenraten und erhöhter Mitarbeitendenzufriedenheit.
WIE LERNEN WIR ACHTSAMKEIT?
Es lässt sich eine formelle und eine informelle Praxis unterscheiden.
Die formelle Praxis
Was regelmässiges Fitness-Training für unseren Körper, ist Meditation für unseren Geist. Meditation kultiviert präsent zu sein.
Ort und Sitzposition:
Wir müssen dazu auch nicht den Schneidersitz einnehmen. Wir können auf einem Stuhl sitzen oder auf einem Ball, ein Meditationshocker und -kissen sind ebenfalls willkommen. Es geht darum, dass wir eine Haltung finden, in der wir möglichst ruhig, wach und entspannt sein können. Ein aufrechter Rücken bewirkt, dass sich die Brust öffnet, wir frei atmen können und ein ungehinderter Energiefluss zustande kommt. Der Platz sollte ruhig, ungestört und angenehm sein (Handy still schalten).
Meditation:
Wir starten damit, uns auf die Atmung zu konzentrieren. Dabei spüren wir immer wieder, dass unser Geist abschweift. Wenn Gedanken und Gefühle entstehen, nehmen wir sie wahr ohne zu analysieren oder zu bewerten. Wir unterdrücken weder Gefühle noch Gedanken, sondern betrachten sie, wie sie von Moment zu Moment entstehen. Wir nehmen wahr und kommen wieder zum Atem zurück. Wir tun das mit einer Haltung von Offenheit und Neugierde. Alle Gedanken, die auftauchen sind willkommen – wir lassen sie wieder ziehen.
Der Schlüssel der Achtsamkeitspraxis liegt nicht so sehr im Objekt unserer Aufmerksamkeit, sondern in der Qualität der Aufmerksamkeit, die wir jedem Moment entgegenbringen. Ausserordentlich wichtig ist, dass die Aufmerksamkeit einem stillen Zusehen, einem unparteiischen Beobachten gleicht, das nicht bewertet oder die inneren Erfahrungen ständig kommentiert. Ein reines, urteilsfreies Wahrnehmen der Moment-zu-Moment-Erfahrung hilft uns zu sehen, was in unserem Geist geschieht, ohne dies zu verändern oder zu zensurieren, ohne es zu intellektualisieren oder uns in unaufhörlichem Denken zu verlieren.
Wir starten mit 5 Minuten und erhöhen langsam auf 10 Minuten täglich. Ein Wecker oder eine Sanduhr sind dabei hilfreich. Wir finden zu einer Zeitspanne, die für uns stimmig ist. Und so trainieren wir unseren Geist, ohne das Leben komplett auf den Kopf stellen zu müssen – vergleichbar mit unserem Körper beim Fitness-Training verändert sich unser Geist durch die Meditation.
Die informelle Praxis
Das ist eine spezifische Art in der Welt zu sein und in Kontakt zu treten. Wir können in jeder Sekunde unseres Lebens üben, indem wir im Augenblick präsent sind und bewusst wahrnehmen: Ich sitze gerade, höre ich noch zu oder blicke ich aus dem Fenster und denke, was mache ich heute Abend? Wir können bei jeder Tätigkeit in den Modus der Achtsamkeit schalten. Das, was uns häufig schwerfällt, ist uns daran zu erinnern. Wir schweifen sehr schnell ab.
Was können wir tun, um die Erinnerungen zu schaffen, damit Achtsamkeit Teil des täglichen Handelns wird? Um uns daran zu erinnern, sind physische Erinnerungen sehr hilfreich: ein gelber Punkt auf dem Notebook, ein Achtsamkeitsgong am Handy, eine Achtsamkeitserinnerung im Kalender, ein Erinnerungssymbol am Schreibtisch – heute schon durchgeatmet?
Oder: Eine Tätigkeit suchen, die wir ganz bewusst machen wollen: abwaschen, Kind zu Bett bringen, Zähneputzen. Am besten eine, die Sie gerne machen. Der Körper hilft dabei: Wie fühlt es sich an, wie Sie jetzt sitzen…?
Um körperlich fit zu bleiben, gehen wir die Treppen hoch anstatt mit dem Lift zu fahren, um den Geist zu beruhigen und fit zu halten, integrieren wir Achtsamkeit in unseren Alltag.
Wenn Sie sich und ihrer Gesundheit etwas Gutes tun wollen, hier eine kleine Übung: Halten Sie immer wieder kurz inne, atmen Sie drei Mal im eigenen Rhythmus tief durch, spüren Sie Ihre Füsse am Boden und nehmen Sie wahr, was gerade ist… Und was um Sie herum ist: Welche Details gibt es in ihrer Umgebung…? Wie riecht es…? Was ist zu hören…? Was fühlen Sie gerade jetzt…? Kommen Sie (immer wieder) in Kontakt mit sich selbst und genießen Sie die Augenblicke der Achtsamkeit, z.B. die blühenden Bäume, die warme Frühlingsluft oder auch die Antwort der Kollegin am Montagmorgen, als Sie gefragt haben: „Wie war das Wochenende?“ Es gibt nichts zu tun und nichts zu erreichen. Sie machen eine kleine Pause.
Hier sind einige Apps zur Unterstützung Ihrer Meditation: z.B. 7Mind, Calm, Headspace.
Die aktuelle Situation des Lockdown ist herausfordernd und für viele Menschen schwierig zu ertragen. Sie stellt aber auch eine Chance dar, eine Praxis der Achtsamkeit in unseren Alltag zu integrieren, die uns auch für die Zukunft resilienter macht.
*Die Wurzeln der Achtsamkeitspraxis liegen in den zweieinhalbtausend Jahre alten buddhistischen Lehren. Dass wir ihre heilsamen Grundlagen und Übungen in einem säkularen Kontext nutzen können, haben wir vor allem dem Medizinprofessor Dr. Jon Kabat-Zinn zu verdanken. Ende der 1970er-Jahre entwickelte der an der University of Massachusetts ein achtwöchiges medizinesch Programm mit dem Namen MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Das Programm baut auf den Übungen der buddhistischen Achstamkeitspraxis und den Erkenntnissen von Verhaltensmedizin und modernen Neurowisschenschaften auf.
Im Zuge der wissenschaftlichen Erforschung dieses weltanschaulich neutralen Programms wurden die heilsamen körperlichen und psychischen Wirkungen der Achtsamkeitspraxis und der dazugehörigen meditativen Übungen bestätigt.
Weiterführende Literatur:
- Detlief Beeker (2020): Meditation leicht gemacht: Wie du maximale Entspannung findest, Stress bewältigst und Ängste löst. Meditieren lernen mit 10 abwechslungsreichen Meditationen für mehr Energie
- Glück, Andreas: Die Gesellschaft der Singularitäten – Zum Strukturwandel der Moderne, Berlin 2017
- Jon Kabat-Zinn, Horst Kappen (2013): Gesund durch Meditation: Das grosse Buch der Selbstheilung mit MBSR
- Jon Kabat-Zinn (2010): Die MBSR-Yogaübungen: Stressbewältigung durch Achtsamkeit; Kommentiertes Hörbuch
- Jon Kabat-Zinn, Reinhard Eichelbeck (2014): Stressbewältigung durch die Praxis der Achtsamkeit, Hörbuch
- Jack Kornfield, Reinhard Eichelbeck (2015): Meditation für Anfänger: mit 6 geführten Audiomeditationen für Einsicht, innere Klarheit und Mitempfinden.
- Sarah Lehm (2017): Meditation lernen: So einfach verschaffen Sie sich mehr Ausgeglichenheit, Gelassenheit und Energie für den Alltag
- Sebastian Purps-Pardigol (2016): Führen mit Hirn: Mitarbeiter begeistern und Unternehmenserfolg steigern
- Chade-Meng Tan, Andrea Panster (2012): Search Inside Yourself: Das etwas andere Glücks-Coaching